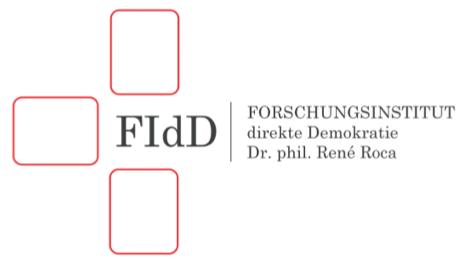Forschungsinstitut direkte Demokratie
1. Historische Grundlagen
Die schweizerische direkte Demokratie mit ihrer spezifischen politischen Kultur entwickelte sich im 19. Jahrhundert sehr unterschiedlich, aber immer von unten nach oben, also aufbauend auf den genossenschaftlich verfassten Gemeinden über die Kantonsebene bis zum Bund. Tragend in diesem Prozess waren die theoretischen Elemente des Genossenschaftsprinzips, des christlichen und modernen Naturrechts sowie der Volkssouveränität.
Stellt man die schweizerische direkte Demokratie in einen europäischen und internationalen Zusammenhang, müssen folgende historische Fakten festgehalten werden:
- Obwohl die Veränderungsprozesse des politischen Systems der Schweiz vom 18. Jahrhundert an von teilweise unterschiedlichen Bedingungen in den eidgenössischen Orten (Kantonen) ausgingen, waren die Ergebnisse hinsichtlich der demokratischen Institutionen ähnlich. In anderen europäischen Ländern finden sich zwar entsprechende Ausgangsbedingungen, aber praktisch keine vergleichbaren politischen Prozesse.
- Ähnlich wie in Grossbritannien, in den USA und zeitweise in Frankreich, aber im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten entwickelten sich in den schweizerischen Kantonen in der Folge der Französischen und Helvetischen Revolution sehr früh naturrechtlich begründete, liberal-repräsentative Verfassungssysteme. Als erster Kanton schuf das Tessin eine liberale Verfassung. Ab 1830/31 folgten im Zuge der Regeneration zehn weitere Kantone, in denen liberal-repräsentative Verfassungen durchgesetzt wurden. Dies waren die Kantone Aargau, Bern, Freiburg, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt und Zürich. Im Kontext des schweizerischen Staatenbundes gab die Souveränität den Kantonen Raum für innere Reformen, die auch durch die ab 1815 völkerrechtlich anerkannte immerwährende Neutralität gefördert wurden. Aufgrund des neutralen Status gab es nur noch vereinzelte ausländische Versuche, die Schweiz zu erpressen oder mit Repressalien auf einen restaurativen Weg zu zwingen. Im Gegenteil fanden viele politische Flüchtlinge in der Schweiz Asyl, die ihrerseits die schweizerische Demokratisierung tatkräftig unterstützten (so etwa die Gebrüder Snell).
- Die kantonalen Verfassungen wurden seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts im Unterschied zu Grossbritannien und Frankreich (einzelne Staaten in den USA folgten erst Ende des 19. Jahrhunderts) mit direktdemokratischen Instrumenten ergänzt, zuerst mit dem Gesetzes-Veto. Später wurde das Veto zu einem obligatorischen oder fakultativen Referendum ausgebaut und als solches in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Rahmen des Bundesstaates auch auf die nationale Ebene übertragen. Damit entstand – neben und mit der Entwicklung der Gesetzes- und Verfassungsinitiative – ein demokratisches Modell, das bis heute europa- und weltweit einmalig ist.
- Im historisch-geographischen Raum der Schweiz trug vor allem die ländliche Bevölkerung als eigentliche Volksbewegung bei diesem Demokratisierungsprozess liberale Konzepte mit und war hauptverantwortlich für direktdemokratische Forderungen. Die ländlichen Volksbewegungen setzten letztlich die direkte Demokratie durch. Entscheidend war die temporäre Verbindung und/oder die gegenseitige Befruchtung von frühsozialistischen, liberal-radikalen Ansätzen mit katholisch-konservativen Vorstellungen, die auf unterschiedlichen theoretischen Wegen dasselbe Ziel verfolgten, nämlich mehr direkte Demokratie zu schaffen und damit die politische Konkretisierung der Volkssouveränität zu verwirklichen. Dies geschah im Gegensatz zu liberalen Konzepten, die eine repräsentative Demokratie bevorzugten. Damit wurde im 19. Jahrhundert eine bis ins Spätmittelalter zurückverweisende longue durée der politischen und genossenschaftlichen Kultur fortgesetzt und verstärkt. In diesen Zusammenhang gehört auch die genossenschaftliche Demokratie der Landsgemeinde, die besonders bei der Schweizer Landbevölkerung auf grosses Interesse stiess. Die «Volkstage», die ab 1830 in verschiedenen Kantonen durchgeführt wurden, nannten sich ausdrücklich «Landsgemeinden».
2. Methode und theoretisches Konzept
Im Rahmen des Forschungsinstituts arbeite ich mit der bewährten «Historisch-kritischen Methode». Anhand der Erschliessung und Auswertung von Quellentexten hat die Historiographie ein systematisches Vorgehen entwickelt, die sogenannte historisch-kritische Methode.
Der Begriff «Methode» umfasst als seriöse Arbeitstechnik den gesamten Weg vom blossen sprachlichen «Verstehen» eines Textes bis zu seiner Interpretation und der zwingenden Einordnung in einen grösseren historischen Kontext. Das Adjektiv «kritisch» qualifiziert diesen Methodenbegriff in dreierlei Hinsicht:
a) als philologisch-hermeneutische Textkritik
b) als historische Kritik
c) als Ideologiekritik
ad a) Ausgehend vom «methodischen Zweifel» hinsichtlich Autorschaft, Entstehungszeit und des Wortlauts selbst, vermag der Historiker mit den philologischen Hilfsmitteln, besonders mit der Sprachgeschichte, Wortgeschichte und Stilkritik, seine Quellen zu analysieren. Eng verbunden mit der philologischen Textkritik ist die Deutung eines Textes, und zwar die textimmanente Auslegung, die Hermeneutik. Eine klare Trennung von «Kritik» und «Deutung» ist allerdings bei der praktischen Arbeit mit den Quellen nur selten durchführbar. Auch die Textkritik beinhaltet immer schon Elemente der Deutung, es gibt also eine ständige Wechselwirkung der beiden Faktoren.
ad b) Die Historiographie kann nicht bei Texten und ihrer philologisch-hermeneutischen Auslegung stehen bleiben. Zur historischen Kritik gehören die weiterführenden Fragen, und zwar
- in welcher Beziehung der jeweilige Text zu seiner zeitgenössischen «Realität» steht,
- auf welchen Ausschnitt dieser Realität er sich bezieht sowie
- unter welcher Perspektive diese Realität betrachtet worden ist.
ad c) An diese historische Kritik, die sich vor allem auf eine kritische Überprüfung überlieferter «Fakten» und «Verhältnisse» richtet, schliesst sich die «Ideologiekritik» an, die sowohl Fragen nach dem politischen und weltanschaulichen Standpunkt des Verfassers eines Textes als auch nach dem Standpunkt des Historikers als Träger der Forschung einschliesst.
Im Weiteren ist eine klare Abgrenzung zur sogenannten Kritischen Theorie (Freudo-Marxismus), zu «postmodernen» Ansätzen (z.B. Dekonstruktivismus) sowie zu ökonomistischen Theorien, die lediglich ökonomisch verwertbares Wissen erzeugen wollen, vorzunehmen. Gerade das christliche und moderne Naturrecht als wissenschaftliche Grundlage für Demokratie und Menschenrechte wird seit geraumer Zeit kaum mehr beachtet. An Schulen und Universitäten wird das Naturrecht als einer unter vielen «Zugängen» und oft im Gegensatz zu «modernen und progressiven Weltbildern» eingebracht und damit abgewertet. So versuchen Historiker und andere Geisteswissenschaftler mit postmodernen und ahistorischen Ansätzen die «postdemokratische» resp. «transnationale» Zeit einzuläuten. Deutlich festzuhalten ist, dass die historisch-kritische Methode auf einem fundierten Wissenschaftsbegriff basiert, der sich den Kriterien der Zweckfreiheit, der Überprüfbarkeit sowie der Allgemeingültigkeit verpflichtet und von einer objektiven Realität ausgeht.
Die Historische Methode ist nach wie vor grundlegend für den «Verstehensprozess» des Historikers wie für eine wissenschaftliche Theoriebildung der Geschichte. Nach zahlreichen eigenen Forschungsarbeiten und nach einer grösseren Studie zum Thema bin ich überzeugt, dass die historisch-kritische Methode für die Erforschung der direkten Demokratie die angemessene Methode ist.
Randnotiz:
Dieses methodisch-theoretische Konzept war die Grundlage, um mit der Unterstützung von Wissenschaftskollegen ein zweites Mal beim Schweizerischen Nationalfonds (SNF) ein Forschungsprojekt mit dem Titel «Wege zur direkten Demokratie in den schweizerischen Kantonen» einzureichen. Obwohl zwei befürwortende externe Gutachten von Historikern vorlagen, setzte die Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften des Nationalen Forschungsrats der SNF aufgrund eines intransparenten internen Verfahrens das überarbeite Forschungsprojekt abermals auf die tiefste Prioritätenstufe. Ich werde dessen ungeachtet meine Forschungsvorhaben weiter vorantreiben.
3. Wissenschaftliche Projekte
In den letzten Jahren wurde mit einigen Detailstudien die Erforschung der direkten Demokratie in der Schweiz gefördert. Diese Studien geben zwar erhellende Antworten auf Detailfragen, viele Forschungsfelder liegen aber noch brach. Die Studien führen deutlich vor Augen, dass sich die Genese der direkten Demokratie historisch sehr unterschiedlich vollzog und dafür jeweils der kantonale Kontext verantwortlich war. Sicher ist, dass es nicht nur ein oder zwei Wege zur direkten Demokratie in der Schweiz gab. Die Entstehung und Entwicklung der direkten Demokratie ist folglich nur erklärbar, wenn die Gemeindeebene und die einzelnen Kantone untersucht werden. Ausgehend von den Entwicklungen der kantonalen Ebene wird deutlich, wieso die Einführung direktdemokratischer Instrumente auch auf gesamtstaatlicher Ebene erfolgreich war.
Um die Forschungen zur Demokratiegeschichte voranzubringen, gründete ich im September 2006 das «Forum zur Erforschung der direkten Demokratie». Wichtige Anregungen dazu gab mir Prof. Dr. Martin Schaffner, der selbst zusammen mit Prof. Dr. Andreas Suter 1998 ein Nationalfondsprojekt initiiert hatte. Das damalige Projekt unter dem Titel «Direkte Demokratie in der Schweiz (1789-1872/74): Voraussetzungen, Träger und Durchsetzung einer Verfassungsinstitution in internationaler vergleichender Perspektive» bildet einen wichtigen Bezugspunkt.
Inhaltlich schloss das «Forum» an dieses Projekt an mit dem Ziel, die historiographische Demokratieforschung in der Schweiz aufzuarbeiten sowie weitere Forschungsprojekte anzuregen und zu unterstützen. Diesen Zielen dienten regelmässige Arbeitstreffen, die im Sinne einer Vernetzung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den interdisziplinären Austausch fördern. Auf diese Weise leistete ich bereits wichtige Grundlagenforschung. Mittlerweile habe ich das «Forum» zu einem eigenständigen Institut weiterentwickelt. Mit dem «Forschungsinstitut direkte Demokratie» knüpfe ich an die Idee und die Grundlagenforschung des «Forums» an und unterstütze weitere Projekte, bin im Bereich Beratung tätig und organisiere Veranstaltungen und Vorträge. Seit 2014 veranstaltete ich mehrere wissenschaftliche Konferenzen und veröffentlichte die Referate in Tagungsbänden im Rahmen der wissenschaftlichen Reihe «Beiträge zur Erforschung der Demokratie».
Dr. phil. René Roca